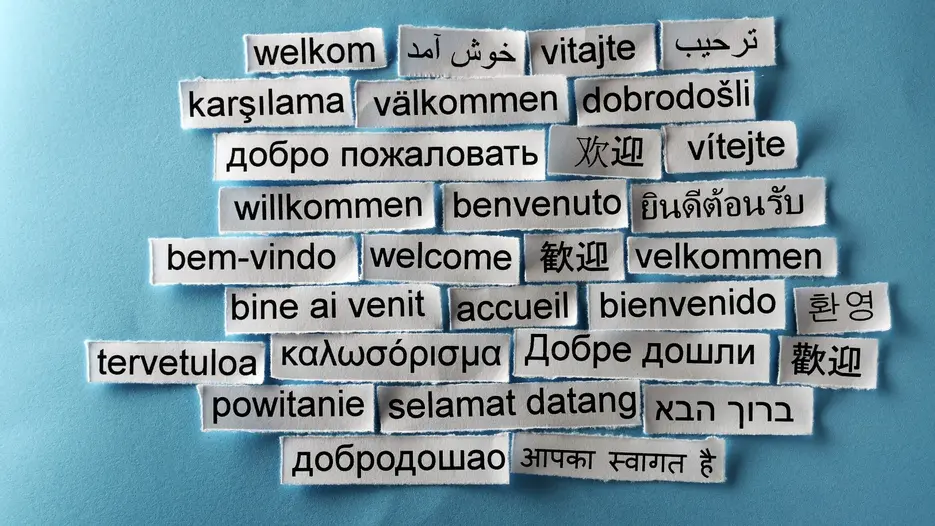1. Was zeichnet eine Muttersprache im Vergleich zu anderen erlernten Sprachen aus?
‚Muttersprache’ ist ein allgemein gesellschaftlich verwendeter Begriff mit daher unscharfer Bedeutung. Oft wird darunter die ‚Sprache des kulturellen Erbes‘ im Sinn von heritage language verstanden – ein Terminus, den die Sprachwissenschaften bevorzugen, wie auch die Bezeichnungen ‚Erstsprache‘ oder engl. native speaker. Nach diesem Verständnis wird die ‚Muttersprache’ ohne gezielten Sprachunterricht von den Eltern bzw. ersten Bezugspersonen erlernt. Sie ist prägend für die Sprachbiographie eines Sprechers und kann evtl. auch ein Dialekt sein. Sie muss nicht unbedingt die am meisten benutzte oder am besten beherrschte Sprache im Verlauf einer Sprachbiographie sein, hat aber in jedem Fall eine sehr starke emotionale Bedeutung für den Sprecher.
Die Hirn- und Spracherwerbsforschung hat Zeitfenster für Früh-/Spätlerner definiert, in denen man akzentfrei eine Sprache erlernen kann (Aussprache im Lebensalter zwischen drei und sechs Jahren, ein intuitiver Grammatikzugang ist bis zur Pubertät möglich). Ursache dafür ist, dass bei einem späteren Erwerb einer weiteren Sprache erst neue neuronale Netze im Gehirn ausgebildet werden müssen. Im Gegensatz dazu nutzen Menschen, die in früher Kindheit zwei Sprachen parallel erlernen, dasselbe neuronale Netzwerk. Dieses steht dann – vereinfacht gesagt – auch für den Erwerb weiterer Fremdsprachen zur Verfügung. Aber als kleiner Trost: Das Wissen über Sprachen – also Sprachverstehen – und Wortschatzwissen kann in jedem Alter erworben werden.
„Muttersprachen“ werden außerdem oft intuitiv genutzt. Muttersprachler sind in der Lage, korrekte Sätze automatisiert zu bilden, ohne die zugrunde liegende syntaktische Struktur (für den Aussagesatz im Deutschen: Subjekt – Prädikat – Objekt) reflektiert zu haben oder sie erklären zu können. Fragt man einen Deutsch-als-Fremdsprache-Lerner, wird er die Systematik der Konstruktion eher analytisch beschreiben können. Dafür fehlt ihm möglicherweise das Verständnis metaphorischer oder idiomatischer Bedeutungen.
In unserem Sammelband zu deutsch-türkischen Sprachbiographien zeigt Katharina König von der Universität Münster anhand von Interview-Beispielen mit bilingual deutsch-türkischen Sprecherinnen und Sprechern, dass die jeweiligen Befragten den Schlüsselbegriff ‚Muttersprache’ unterschiedlich verstehen und verwenden: Wer erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen ist, versteht seine Muttersprache als Kompetenzvorsprung für die neue Umgebung. Länger in Deutschland Lebende oder hier Geborene sehen ‚Muttersprache’ vor allem als ‚Sprache des kulturellen Erbes’ und verbinden damit die Sorge um einen drohenden und zu vermeidenden Sprachverlust. Menschen der zweiten Generation sehen Deutsch mitunter als eine ihrer Muttersprachen. Der Begriff ist im Hinblick auf Mehrsprachigkeitsforschung also neu zu interpretieren und eben nicht mehr nur auf eine Sprache zu beschränken.
2. In der globalen Kommunikation hat sich Englisch als Weltsprache etabliert. Welche Rolle spielt die Muttersprache in Gesellschaften, die sich aus vielen Nationalitäten zusammensetzen – sowohl im Hinblick auf die aufnehmenden Länder als auch bezogen auf die Ankommenden?
In einer globalen Welt, in der sich die meisten in der lingua franca Englisch verständigen können, hat die Muttersprache vor allem identitätsstiftende Bedeutung für ihre Sprecherinnen und Sprecher – dies gilt in ganz besonderem Maße für Regionalsprachen und Dialekte. Sprache wird zur ‚portablen Heimat’ (nach Heinrich Heine) – ein Bezugspunkt für diejenigen, die ihre nationalstaatliche Heimat verloren haben.
Diversity – sprachliche Vielfalt – ist ein Reichtum und bietet viele Chancen: für jeden einzelnen Sprecher, aber auch für eine Gesellschaft. Damit dies individuell und gesellschaftlich gelingen kann, sind mehrere bildungspolitische Voraussetzungen notwendig: Zum einen müssen bilinguale Lerner und Neuankömmlinge frühzeitig mit Förderunterricht im Deutschen unterstützt werden, damit sie von Anfang an am Unterrichtsgeschehen oder Arbeitsalltag partizipieren können. Die deutsche Sprache hat für den Bildungserfolg in sämtlichen Fächern eine Schlüsselfunktion, das haben zahlreiche Studien der vergangenen Jahre gezeigt. Gleichzeitig muss die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler als Ressource viel stärker didaktisch einbezogen werden – etwa durch Sprachvergleich –, um das Sprachbewusstsein der Lerner nutzbar zu machen. Dabei muss allen Herkunfts- und Zweitsprachen der Schüler/innen entsprechende Wertschätzung entgegengebracht werden, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken.
Es ist geradezu paradox: Wir alle möchten im Lauf unseres Lebens mehrerer Fremdsprachen erlernen und bewundern Mehrsprachige, legen aber offenbar unterschiedliche Prestige-Maßstäbe bei den Sprachen an: Ein deutsch-türkischer Schüler oder eine russisch-deutsche Arbeitskollegin werden sprachlich nur an der Perfektion ihrer Deutschkenntnisse gemessen, während man bei Zweisprachigen mit den klassischen Schul-Fremdsprachen Englisch, Französisch, Spanisch usw. die bilinguale Kompetenz in den Vordergrund stellt. Dem könnte man beispielsweise durch eine Erweiterung des Kanons der Fremdsprachen an Schulen um Türkisch, Polnisch, Ungarisch usw. begegnen.
3. Der Tag der Muttersprache widmet sich vor allem Sprachen, die von Minderheiten gesprochen werden. Es heißt, dass sich auch Dialekte, die in ihrer Verbreitung regional begrenzt sind, auf dem Rückzug befinden. Wird die deutsche Sprache immer einheitlicher?
Tatsächlich ist ein Rückgang lokal eng begrenzter Ortsmundarten, der sogenannten Basisdidalekte, zu beobachten – zugunsten von regionalen Umgangssprachen.
Durch die verstärkte Mobilität und Medienpräsenz in einer globalen Welt mit vielfältigen Sprachkontakten spielen regional beschränkte Sprachen heute eine andere Rolle – sie sind eher Identitätsstifter, weniger einziges Kommunikationsmittel wie bei den Sprechern früherer Generationen. Die meisten können sich heute sowohl in der Standardsprache als auch im Dialekt verständigen – häufig zusätzlich noch auf Englisch und in weiteren Fremdsprachen.
Bei der Dialektkompetenz spielen die Unterschiede von Stadt und Land eine entscheidende Rolle: In unserem Dialekt-Forschungsprojekt Sprache im Fluss haben wir gesehen, dass Schüler in ländlichen Gebieten durchaus noch dialektkompetent sind, aber auch eine Veränderung ihres Dialekts im Vergleich zur Eltern- und Großelterngeneration bemerken. Schüler an städtischen Schulen möchten gerne Dialekt sprechen und verstehen auch noch einiges, nutzen den Dialekt aber oft nicht mehr dauerhaft als Kommunikationsmittel, sondern eher – wie eine Fremdsprache – in bestimmten Situationen, etwa zur informellen Kommunikation mit der Familie oder als gruppensprachliche Markierung mit ihren Freunden.
In einem föderal organisierten Land wie Deutschland mit einer nationalen Standardsprache, die sprachhistorisch aus dem großen dialektalen Reichtum entstanden ist, wird es nie eine Einheitssprache als einziges Kommunikationsmittel geben – die Prognose wage ich. Regionale Besonderheiten werden gerade in einer globalen Welt als identitätsstärkender Bezugspunkt bestehen bleiben.
 Dr. Monika Raml ist an der KU wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur.
Dr. Monika Raml ist an der KU wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur.
Interview: Constantin Schulte Strathaus